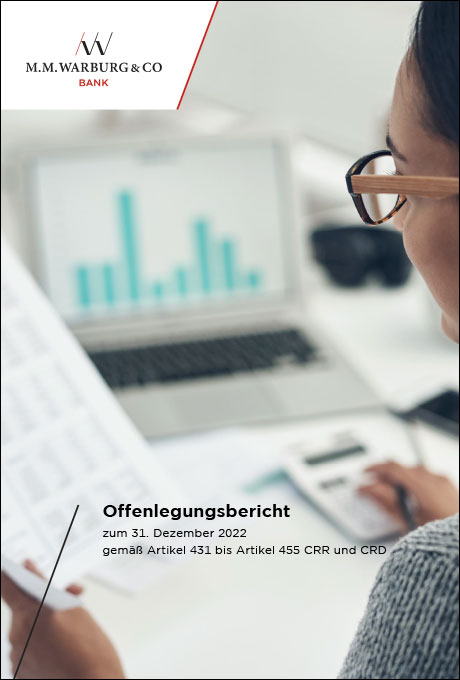Beitrag von Carsten Klude
Zu den wichtigsten fundamentalen Einflussfaktoren für die Zinsentwicklung zählen zweifellos die Inflationsentwicklung und die Geldpolitik der Notenbanken. Nachdem sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank den seit Mitte 2021 zu beobachtenden Inflationsanstieg zunächst auf die leichte Schulter genommen und als „transitorisch“ bezeichnet hatten, haben beide Zentralbanken ihren Leitzins in den vergangenen eineinhalb Jahren drastisch angehoben. Diese geldpolitische Vollbremsung führte 2022 zu einem historisch einmaligen Einbruch der Anleihekurse. In diesem Jahr haben die Kurse von Staatsanleihen dagegen kaum auf die noch restriktivere Geldpolitik der Notenbanken reagiert. Im Gegenteil: Bis Ende Juli waren sogar leichte Kursgewinne zu verzeichnen. Die Schwäche der letzten acht Wochen, die dazu geführt hat, dass zehnjährige Bundesanleihen seit Jahresbeginn nun knapp im Minus liegen und zehnjährige US-Treasuries einen Wertverlust von rund vier Prozent aufweisen, kann daher in gewisser Weise als Nachholeffekt interpretiert werden.
Dass sich die Anleihekurse trotz des geldpolitischen Gegenwinds in diesem Jahr recht ordentlich entwickelt haben, liegt vor allem daran, dass die meisten Marktteilnehmer noch bis vor kurzem davon ausgingen, dass es nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus nicht mehr lange dauern würde bis die ersten Zinssenkungen folgen würden. Der Verlauf dieser Art der Geldpolitik gleicht dem des Schweizer Matterhorns: steiler Aufstieg, ebenso steiler Abstieg. Allerdings geht es mit den Leitzinsen nicht immer so schnell, denn manchmal vergehen 15 oder mehr Monate bis die Leitzinsen wieder gesenkt werden. In diesem Fall ähnelte der Verlauf der Geldpolitik optisch eher dem des südafrikanischen Tafelbergs. Auf der letzten FOMC-Sitzung am 20. September hat die US-Notenbank genau diese „Tafelberg-Haltung“ eingenommen.
Allerdings sollte man die Aussagen der Notenbank nicht für bare Münze nehmen. Ein Blick auf die Prognosen der Vergangenheit zeigt, dass die US-Notenbank mit ihren Einschätzungen oft daneben lag, weil sie sich bei ihren Erwartungen zu eng an den aktuellen Daten orientierte. Auch Notenbanken besitzen eben keine Glaskugel. Wenn sie sagen, dass ihre künftige Geldpolitik „auf Sicht“ oder „datenabhängig“ sei, bedeutet das meist nichts anderes als das Eingeständnis „wir wissen es auch nicht“.
Lesen Sie hier unsere Analyse